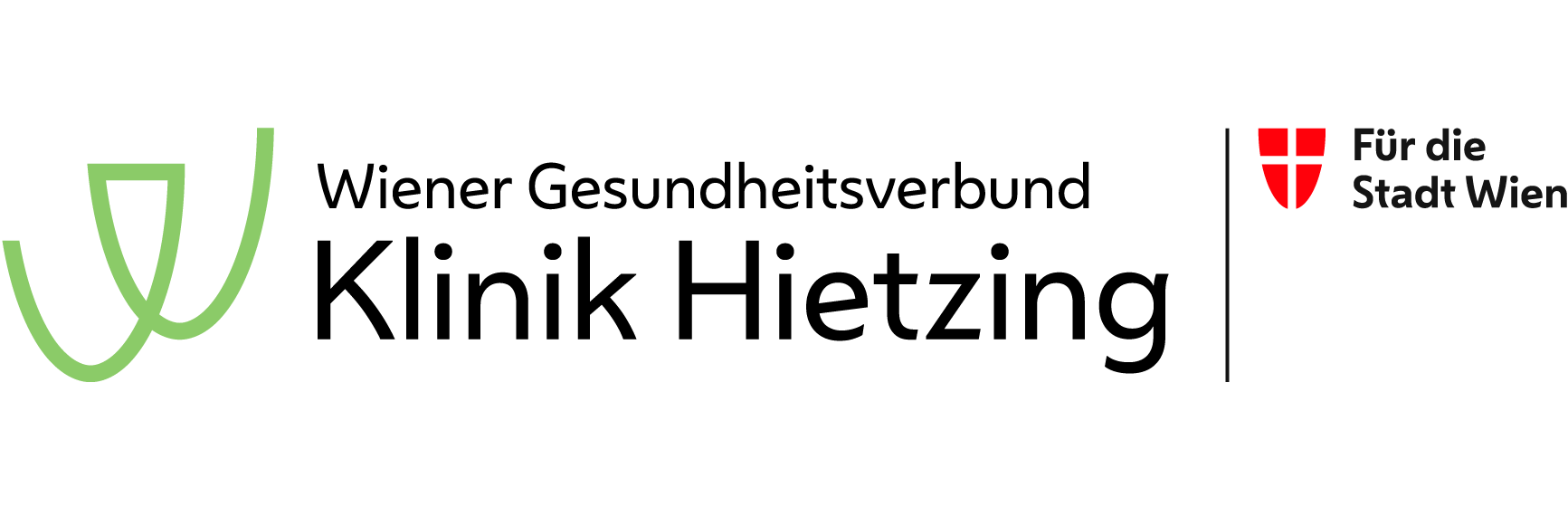Immer mehr Adipositas-Patient*innen: Die Stigmatisierung von Übergewicht
Die Zahl der übergewichtigen Personen in Österreich steigt stetig – viele von ihnen leiden unter Stigmatisierung
Mehr als ein Drittel der über 15-Jährigen in Österreich ist übergewichtig – Tendenz steigend. Rund 17 % der Bevölkerung, also etwa 1,5 Millionen Menschen, sind sogar adipös. Besonders alarmierend ist der Anstieg bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren. Die meisten Betroffenen leiden zudem an Begleiterkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Problemen oder Stoffwechselstörungen. In der Adipositas-Ambulanz der Klinik Hietzing erhalten sie eine umfassende Betreuung. „Adipositas geht häufig mit weiteren gesundheitlichen Herausforderungen einher. Deshalb ist es uns besonders wichtig, die Patient*innen ganzheitlich zu behandeln und Begleiterkrankungen frühzeitig zu erkennen“, erklärt Birgit Jandrasits, Leiterin der Adipositas-Ambulanz der Klinik Hietzing. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Klinik ermöglicht eine gezielte und individuell abgestimmte Therapie.
Stigmatisierung als große Hürde für Betroffene
Neben den gesundheitlichen Folgen leiden viele adipöse Menschen unter sozialer Stigmatisierung. Diskriminierung kann in verschiedenen Lebensbereichen auftreten – von eingeschränkten Jobchancen bis hin zu negativen Erfahrungen im Alltag. „Viele unserer Patient*innen berichten, dass sie aufgrund ihres Gewichts bei der Berufswahl benachteiligt werden oder sich aus Angst vor Vorurteilen nicht mehr ins gesellschaftliche Leben einbringen“, so Jandrasits. Diese Unsicherheiten führen oft zu sozialem Rückzug und vermindertem Selbstwertgefühl. Auch Sport oder Freizeitaktivitäten werden aus Angst vor Verurteilung häufig gemieden.
Um den Patient*innen in der Klinik Hietzing einen angenehmen und würdevollen Aufenthalt zu ermöglichen, wurden spezielle Maßnahmen getroffen: breitere Stühle, größere Blutdruckmanschetten und angepasste Sanitäranlagen erleichtern den Alltag in der Ambulanz. „Kleine Anpassungen können für unsere Patient*innen einen großen Unterschied machen. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohl und verstanden fühlen“, betont Jandrasits.
Moderne Therapien und neue Behandlungsmöglichkeiten
Die medikamentöse Behandlung von Adipositas hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. In der Klinik Hietzing werden regelmäßig neue Medikamente im Rahmen von Studien erforscht, wodurch Patient*innen Zugang zu innovativen Behandlungsmöglichkeiten erhalten. „Wir arbeiten aktiv daran, neue Therapieformen zu entwickeln und unseren Patient*innen moderne medikamentöse Optionen anzubieten. Die klinische Forschung ermöglicht es uns, langfristig bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen“, erklärt Thomas Stulnig, Internist und Abteilungsvorstand der 3. Medizinischen Abteilung – Innere Medizin mit Stoffwechselerkrankungen, Endokrinologie und Nephrologie in der Klinik Hietzing. Gemeinsam mit Jandrasits hat Stulnig die Adipositas-Ambulanz der Klinik Hietzing vor mehr als 2,5 Jahren mit aufgebaut. Für Patient*innen, die eine chirurgische Therapie in Erwägung ziehen, bietet die Klinik Hietzing eine umfassende Beratung an und kann bei Bedarf an die chirurgische Abteilung weiterverweisen. „Unser Ziel ist es, den bestmöglichen Behandlungsweg für jede*n Einzelne*n zu finden – sei es durch Medikation, Lebensstiländerungen oder in ausgewählten Fällen durch einen chirurgischen Eingriff“, fasst Stulnig zusammen.
Individuelle Ernährungsstrategien für nachhaltigen Erfolg
Ein zentraler Baustein in der Behandlung von Adipositas ist die langfristige Anpassung der Ernährungsgewohnheiten. „Es gibt keine universelle Diät, die für alle funktioniert. Entscheidend ist, dass die Strategie individuell auf den Menschen abgestimmt ist und dauerhaft umgesetzt werden kann“, betont Astrid Schlosser, Senior Diätologin in der Klinik Hietzing. Eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung, ein bewusstes Essverhalten sowie das Erkennen von Hunger- und Sättigungssignalen spielen dabei eine wichtige Rolle.
Zusätzlich können Maßnahmen wie Intervallfasten, eine erhöhte Eiweißzufuhr zur Unterstützung der Muskelmasse sowie eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining dabei helfen, den Stoffwechsel langfristig zu regulieren. Auch das emotionale Essverhalten ist ein wichtiger Faktor: „Viele Patient*innen essen nicht aus Hunger, sondern aus Stress oder emotionaler Belastung. Hier ist es wichtig, alternative Bewältigungsstrategien zu entwickeln, etwa durch bewusste Essensplanung, regelmäßige Mahlzeiten und Stressmanagement-Techniken“, erklärt Schlosser. Entscheidend für den Erfolg ist vor allem die Eigenmotivation der Patient*innen.
Weitere Informationen:
3. Medizinische Abteilung – Innere Medizin mit Stoffwechselerkrankungen, Endokrinologie und Nephrologie